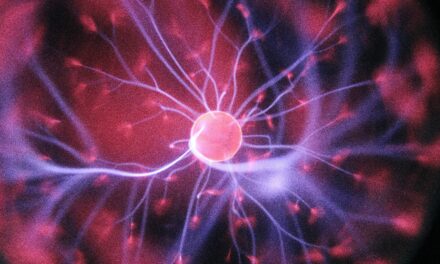SOZIALE VERANTWORTUNG – Die neue Gründergeneration hat sich andere Prioritäten gesetzt. Junge Absolventen machen sich die Lösung sozialer Probleme zur Herzensangelegenheit. Geld verdienen wollen sie damit auch – nur nicht für hohe Renditen.
DüsseldorfEs gibt Berichte über Tim Breker, 25, die ihn als exzellenten Absolventen einer privaten Wirtschaftshochschule beschreiben, der viel Geld hätte verdienen können und stattdessen jetzt etwas Soziales macht. Es sind Berichte, die mit den Klischees über Privatuni-Studenten spielen – und sie stören den Absolventen der WHU – Otto Beisheim School of Management nicht. Sie machen den Gründer, der Schüler unterstützt, in ihrer Schule einen Kiosk zu betreiben und so Verantwortung, Teamgeist und Unternehmertum zu erleben, stolz. „Weil es zeigt, dass ich etwas anders mache“, sagt Breker.
Anders machen – das waren auch zwei Worte, die Tobias Lorenz, 30, nächtelang im Kopf herumgingen. Lorenz, dessen Name ein Doktortitel vorangeht, will Menschen in Entwicklungsländern ein Zusatzeinkommen bieten – als Sprachlehrer, die per Internettelefonie Skype ihre Schüler in Deutschland oder anderen Ländern unterrichten.
Christina Veldhoens Arbeit wiederum beginnt erst nach dem Unterricht. Die Absolventin der privaten Zeppelin Universität Friedrichshafen will Schülern, die es nicht so einfach im Leben haben, Studenten als Mentoren an die Seite stellen. „Dass wir in Deutschland so wenig Bildungsgerechtigkeit haben, ist untragbar. Wir haben uns gefragt, welchen Beitrag wir leisten können“, sagt die 29-Jährige.
Breker, Lorenz und Veldhoen gehören zu einer neuen Generation von Jungunternehmern in Deutschland, bei denen sich die Prioritäten verschoben haben. „Sozialunternehmer“ heißen sie. Sie wollen soziale Probleme lösen und damit Geld verdienen, um es wieder ins Unternehmen zu investieren oder andere soziale Projekte damit anzustoßen – und nicht, um möglichst hohe Renditen zu erzielen. Etliche Preise haben sie dafür bekommen. Und viele Nachahmer. „Jetzt kommt eine Generation von Studenten und Absolventen, die sagt, sie will etwas sinnvolles machen und sich dann fragt: Wo sehe ich ein Problem, dass ich lösen will?“, sagt der Lüneburger Professor Markus Beckmann, der an der Leuphana-Universität zu Sozialunternehmertum forscht.
Zwar gibt es Sozialunternehmer in Deutschland schon lange – nur bisher waren das meist Überzeugungstäter wie Andreas Heinecke, der heute mit seinem „Dialog im Dunkeln“ auch etwa 70 blinde Menschen beschäftigt. Sie führen durch eine Ausstellung, in der es stockdunkel ist, machen den Service in einem Restaurant, in dem sich die Gäste ganz auf ihren Geschmack verlassen müssen, beraten Unternehmen und geben Seminare.
Heinecke gründete nach einem persönlichen Aha-Erlebnis Ende der 1980er Jahre sein Sozialunternehmen. Damals noch Journalist beim Rundfunk, wurde er gefragt, ob er sich vorstellen könnte, einen Blinden zum Journalisten auszubilden. Er hatte keine Ahnung, wie er damit umgehen soll, doch merkte: Der neue Kollege kann Dinge, die ihm verborgen bleiben. „Viele der ersten Sozialgründer haben eine einschneidende Erfahrung gemacht, und daraus ist ihre Geschäftsidee entstanden. Sie sind von einer Idee getrieben, das wirtschaftliche Handeln ist ihr Betriebsmittel und gleichzeitig die Anerkennung, dass sie etwas richtig machen“, sagt Beckmann. Die Hochschulen erkennen das Thema.
Diese Überzeugungstäter bekommen nun Gesellschaft – von Hochschulabsolventen. „Viele derer, die heute ein Sozialunternehmen gründen wollen, kommen dazu nicht aus einem biographischem Zufall oder einer sehr direkten und konkreten persönlichen Betroffenheit, sondern weil sie von der allgemeinen Idee des Sozialunternehmerischen fasziniert sind“, sagt Beckmann. Daher widmen sich die jungen Sozialunternehmer auch neuen Themen.
Während ihre Vorgänger sich sozialen Dienstleistungen, Arbeitsintegration und Bildung verschrieben, gehen viele Jüngere in Richtung Sport, Kultur, Erholung oder sind selbst Dienstleister, die etwa das Spendensammeln professionalisieren. Das sind erste Ergebnisse eines Forschungsprojekts von TU München, Zeppelin Uni und Uni Heidelberg für die Mercator-Stiftung, dessen Ergebnisse Ende Juni vorgestellt werden. In ihrer Umfrage haben die Forscher herausgefunden, dass Sozialunternehmen in Deutschland noch relativ klein sind, mehr als jeder Dritte nimmt jährlich weniger als 100 000 Euro ein.
Dass es aber immer mehr „Social Entrepreneurs“ gibt, zeigen auch die Teilnehmerzahlen der größten deutschen Konferenz für Sozialunternehmertum – dem Vision Summit – die an diesem Wochenende rund 1 300 Gründer und Experten in Berlin zusammenbringt. Auch die Wissenschaft ist aufgewacht und widmet sich dem Phänomen immer stärker: An privaten wie staatlichen Hochschulen sind in den vergangenen Jahren etliche Lehrstühle und noch mehr Konferenzen für Sozialunternehmertum entstanden.
Von dieser Dynamik profitieren auch Christina Veldhoen und ihre zwei Mitgründer. Rock your life! – frei übersetzt Du schaffst es – heißt ihre Firma, mit der sie Schülern für zwei Jahre einen studentischen Mentor an die Seite stellen. Die Idee reifte, als in Deutschland die Debatte über die Hauptschule als „Restschule ohne Perspektive“ tobte. „Wir dachten: Diese Jugendlichen glauben nicht an ihre Talente, weil ihnen nie jemand gesagt hat, dass sie welche haben“, sagt Veldhoen. Sie will das ändern und gewann schon mit dem Konzept einen Preis für Sozialgründer.
2009 an den Start gegangen ist Rock your life! im Franchise-System heute in 25 Städten präsent. Die Gründer haben weitere Pläne: „Wir wollen Rock your life! als Bildungsmarke positionieren“, sagt Veldhoen. Sie wollen in Kindergärten gehen, langfristig Schulen gründen und sich in der Bildungspolitik engagieren. „Jetzt ist der Punkt, wo wir als Gründer größer denken“, sagt sie.
Dem Vorbild der Branche, Muhammad Yunus, ist das schon gelungen. Seitdem er 2006 für seine Grameen-Bank, die in Bangladesh Kredite an die Ärmsten der Armen vergibt, den Friedensnobelpreis bekommen hat, ist das Konzept des Sozialunternehmertums weltweit anerkannt. „In Bangladesch ist das schon einer der wichtigsten Wirtschaftszweige: Die Grameen-Bank etwa ist heute einer der größten Arbeitgeber des Landes“, sagt Vivek Velamuri, von der Leipziger Wirtschaftshochschule HHL. Solche Dimensionen werden Sozialfirmen hierzulande zwar nicht erreichen, aber Probleme gebe es auch hier genug.
Und offenbar auch Menschen, die diese unternehmerisch angehen wollen. „Wir stehen am Anfang einer Bewegung in der immer mehr Menschen das Engagement auch als Karriereoption sehen“, sagt der ehemalige McKinsey-Berater Felix Oldenburg. Er ist Deutschland-Chef der Organisation Ashoka, ein Netzwerk zur Förderung sozialer Unternehmer. Denn unter den neuen Sozialunternehmern „sind auch viele, die schon eine erfolgreiche Karriere hingelegt haben und jetzt noch etwas Sinnvolles tun wollen“, sagt Beckmann.
Vor allem das Platzen der Dotcom-Blase und die Finanzkrise hätten zum Umdenken bewegt, glaubt Oldenburg: „Zusammen stehen diese Ereignisse für eine Entwertung des Geldes und der alten Karrieremuster.“
Noch ist es eine Avantgarde, die sich solch ein Denken leisten kann. Eine Avantgarde, zu der auch Tim Breker gehört. Bevor er seine Firma Em-Schülerfirmennetzwerk aufbaute, ging der WHU-Absolvent zwei Jahre zurück an die Schule – als Lehrer des Teach First Programms; ebenfalls ein Sozialunternehmen, das Absolventen ermutigt, vor dem Berufseinstieg an Schulen in sozialen Brennpunkten zu unterrichten.
Das „krasse Kontrastprogramm zur WHU“ brachte Breker darauf, den Wirtschaftsunterricht in den Schulen praxisnäher zu machen – indem Schüler der achten bis zehnten Klasse einen eigenen Kiosk betreiben. Die Lehrer haben keinen Aufwand, Breker schult die Schüler, und begleitet sie in der zweiwöchigen Testphase, danach schaut er alle zwei Monate vorbei. Die Waren beziehen die Kioske über ihn, das ist Teil seines Geschäftsmodells. Was mit dem Kioskgewinn passiert, entscheiden Schülergruppe und Rektor.
Fünf Schulen hat Breker unter Vertrag, bisher nimmt er Erspartes und den Gründerzuschuss, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. „Ein Jahr Finanzierung brauche ich auf jeden Fall noch“ sagt der Gründer und überlegt, bei vielen Klein-Investoren Geld zu sammeln – Crowdfunding heißt das. Investoren müssen umdenken.
„Die Finanzierung ist definitiv noch eine der Herausforderungen für Sozialunternehmer“, sagt Peter Spiegel, Leiter des Genisis-Instituts und des „Vision Summit“. Tobias Lorenz, der Gründer der Sprachschule via Skype, hat ein halbes Jahr Finanziers gesucht – bis er Glovico aus eigener Tasche, mit Geld von Freunden und Preisgeldern finanziert hat. „Klassische Investoren hatten Interesse, aber dann auch mit klassischen Renditeansprüchen“, sagt er. Auch Crowdfunding-Plattformen hätten mit Unverständnis reagiert. „Ich wehre mich einfach gegen die Idee, von Anfang an den Gewinn maximieren zu wollen“, sagt er.
Christina Veldhoen und ihre Mitgründer bekommen staatliche Zuschüsse, haben Sponsoren sowie Unternehmen, die für das Mentoren-Netzwerk zahlen und rechnen Leistungen mit den Standorten ab. Es ist ein Mix, den viele Sozialunternehmer nutzen, haben die Forscher für die Mercator-Stiftung herausgefunden. Staatliche Förderung macht im Schnitt ein Fünftel aus, Sponsoren und Stiftungen geben etwas weniger. Je jünger die Firmen, desto geringer scheint der Staatsanteil zu sein.
Sozialunternehmer brauchen dennoch neue Finanzierungsinstrumente – Mischungen aus Investorengeld und staatlicher Förderung etwa. „Da experimentieren wir alle noch“, sagt Ashoka-Leiter Oldenburg. Die staatliche KfW-Bank bietet seit Januar eine Co-Finanzierung. Wenn ein Partnerinvestor Geld für ein Sozialunternehmen aufbringt, beteiligt sich die Bank mit bis zu 200.000 Euro. „Es gibt genug Geld in Deutschland, aber zu viel falsches Geld“, sagt Oldenburg. Doch das, ist er überzeugt, ändere sich gerade.
Quelle Handelsblatt